B i o g r a p h i e
Ernst Fritsch war ein klassischer Vertreter der Neuen Sachlichkeit und ein Mensch mit Zivilcourage. Nach der sogenannten "Reichskristallnacht" schlich er sich 1938 heimlich auf eine Rednerbühne in Berlin und protestierte lautstark gegen die Übergriffe auf die Juden. 1943 hat er durch eine waghalsige Aktion eine jüdische Bekannte vor der Deportation nach Auschwitz gerettet. Für diese Aktion wurde er von der Gestapo verhaftet und gefoltert. 1975 erhält Ernst Fritsch von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem den Ehrentitel "Gerechter unter den Völkern".
Der Maler und Grafiker Ernst Fritsch lernt zunächst in einem Berliner Entwurfsatelier für Wandstoffe und Tapeten. Anschließend studiert er ab 1911 an der Königlichen Kunstschule Berlin und wird 1914 zum Kriegsdienst eingezogen. Nach dem Krieg ist er zunächst als Lehrer tätig. Als Mitglied der Berliner Sezession und der "Novembergruppe" ist er an deren Ausstellungen sowie bis 1933 auch an den Werkschauen der Preußischen Akademie der Künste beteiligt.
Künstlerisch setzt sich Fritsch vor allem mit dem städtischen Leben Berlins auseinander. Neben beschaulichen Stadtansichten aus dem Umland und den Vorstädten der Metropole und Stillleben, die sein kubo-expressionistisches Frühwerk bestimmen, sind es aber die großfigurigen Porträts von Personen aus dem Kleinbürgertum, die er in den 1920er Jahren im Stil der Neuen Sachlichkeit malt und die zu den Höhepunkten seines künstlerischen Werkes zählen.
Das Porträt der jungen Frau stammt aus dieser neusachlichen Schaffensphase. Die Reserviertheit der Darstellung und die distanzierte, fast analytische Personenbeschreibung ist für die Malerei von Ernst Fritsch charakteristisch und wohnt seinem gesamten Œuvre inne. Besonders intensiv wird dies in den Porträts der frühen 1920er Jahre deutlich.
Um 1930 wendet Ernst Fritsch sich dem Expressionismus zu und wird nach der ersten Retrospektive in der Berliner Secession von den Nationalsozialisten mit Ausstellungsverbot belegt. Seine Werke werden daraufhin diffamiert, beschlagnahmt und ein Großteil seiner Arbeiten am 20. März 1939 bei der Gemäldeverbrennung vernichtet. 1946 erhält Fritsch eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Berlin-Charlottenburg. 1953-1958 ist er Leiter der Abteilung Kunstpädagogik und übernimmt die Meisterklasse dieser Abteilung. 1956 wird er Mitglied der Akademie der Künste Berlin.
Nach dem Krieg erfährt sein malerisches Werk einen radikalen stilistischen Wandel. In einer heiteren Farbpalette schildert er surreale Bildwelten, in denen die einzelnen Gegenstände zu chiffrenartigen Zeichen abstrahiert sind. Der gesamte künstlerische Nachlass von Ernst Fritsch geht 1991 an die Sammlung der Berlinischen Galerie, die ein Jahr später anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers eine umfassende monografische Ausstellung zeigt.
Quelle: Auktionshaus Ketterer-Kunst München
Gerechter unter den Völkern
Auf der Webseite der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ist zu Ernst Fritsch folgendes zu lesen: "Der Maler Otto Ernst Fritsch, ein langjähriger Gegner des NS-Antisemitismus, gehörte vor 1933 der Sozialdemokratischen Partei an. Nach dem Novemberpogrom 1938 schlich sich Fritsch in einer öffentlichen Versammlung in Berlin-Charlottenburg an die Rednertribüne und protestierte lautstark gegen die Übergriffe auf die Juden. Während mehrere Mitglieder der NSDAP versuchten, ihn anzugreifen, wurde er von Freunden in Sicherheit gebracht. Nachdem er mehrere Wochen im Verborgenen gelebt hatte, suchte er Zuflucht bei der Wehrmacht und meldete sich Anfang 1939 zur Luftwaffe. Im Frühjahr 1943 war Fritsch in Tirol beurlaubt. Er erholte sich von den Verletzungen, die er sich bei einem Angriff des französischen Widerstands auf den Zug zugezogen hatte, in dem er unterwegs war.
Der örtliche Leiter der Gestapo für den Gau Tirol-Vorarlberg war ein fanatischer Nazi namens Werner Hilliges. Bestrebt, seinen Gau als "judenrein" zu erklären, ordnete Hilliges über seine eigenen Befugnisse hinaus die Deportation aller jüdischen Ehefrauen aus Mischehen nach Auschwitz an. Von seinen Eltern erfuhr Fritsch, dass sich unter den verhafteten jüdischen Ehefrauen auch eine Freundin der Familie aus Innsbruck, Frau Josephine Willerth, befand. Zu diesem Anlass schlüpfte Fritsch in die volle Uniform eines Unteroffiziers der Luftwaffe und marschierte mutig an den Untergebenen vorbei in die Büros des Innsbrucker Polizeipräsidenten und des stellvertretenden Gauleiters und drohte, dass Hilliges vor ein NSDAP-Tribunal gestellt würde. Er argumentierte, dass die von ihm ergriffenen Maßnahmen illegal seien, da Hitler selbst angeordnet hatte, dass die jüdischen Ehefrauen aus Mischehen geschützt werden sollten.
Die Gestapo versuchte ihn mit falschen Anschuldigungen zu belasten, doch zu diesem Zeitpunkt war er noch durch seinen militärischen Rang geschützt. Als dieser „Tiroler Seitensprung“ jedoch von einem Militärsender aus London publik gemacht wurde, gab es nichts mehr, was ihn schützen konnte. Er wurde von der Gestapo verhaftet, schwer gefoltert und als „Judenfreund“ bezeichnet – eine schwere Bürde im nationalsozialistischen Deutschland. Die Deportation der Tiroler und Vorarlberger Juden wurde einige Zeit später von höheren Stellen gestoppt. Am 18. Februar 1975 erkannte Yad Vashem Otto Ernst Fritsch als Gerechten unter den Völkern an".
Quelle: Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem, Filenr. M.31.2/275
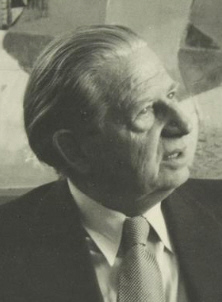
Ernst Fritsch